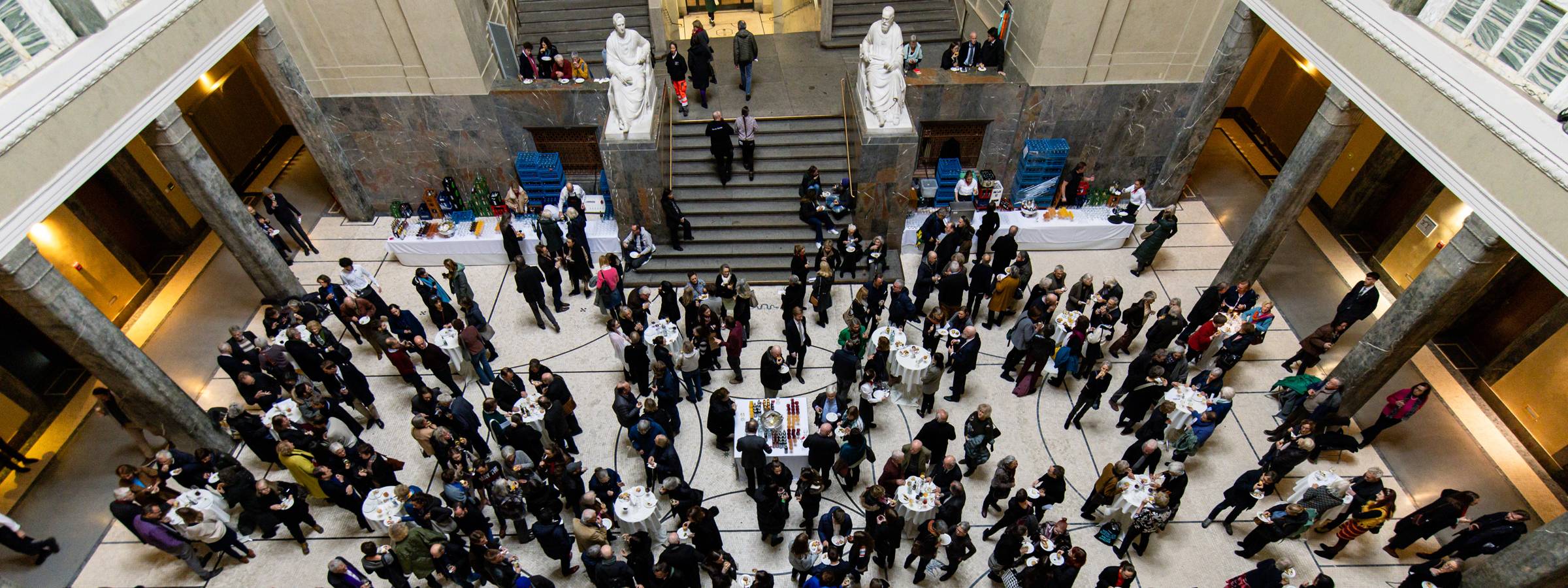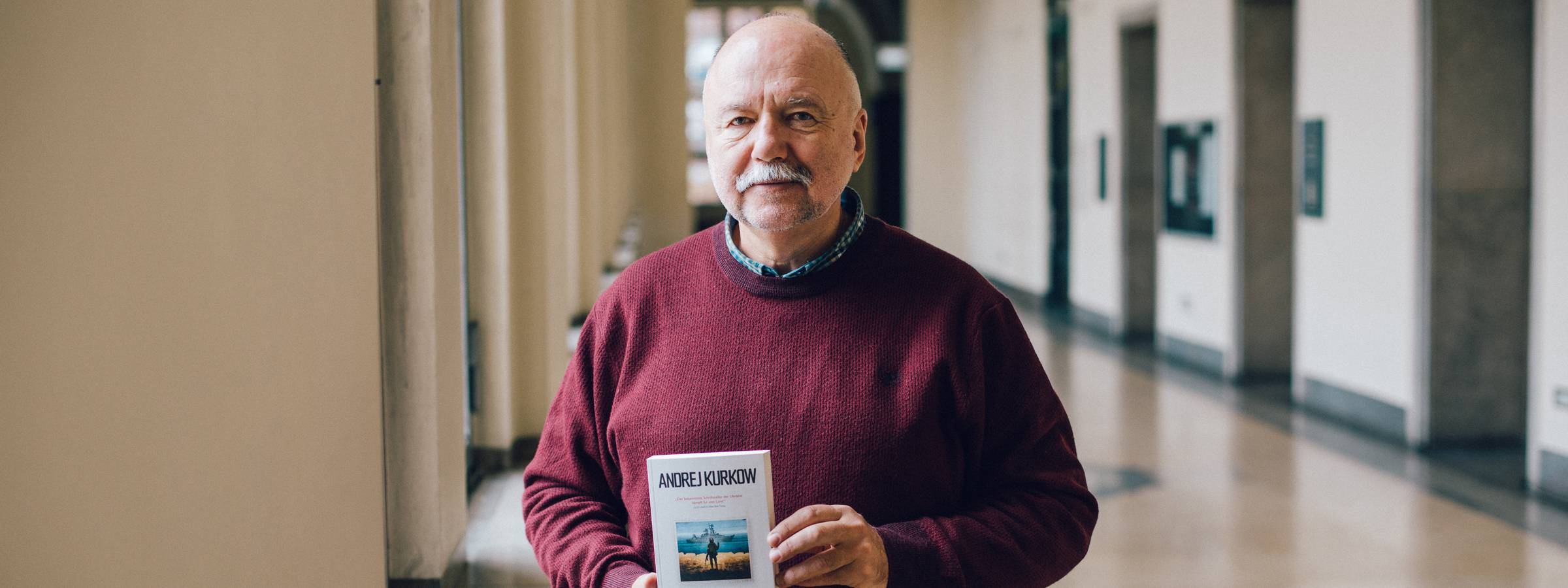von Elisabeth Bauschmid
Das Essay ist der Broschüre "25 Jahre Geschwister-Scholl-Preis" (2004) entnommen.
Vor einem halben Jahr, am 19. Mai 2004, erhielt Bundespräsident Horst Köhler, damals noch Kandidat, Post von Rolf Hochhuth. Hochhuth, der ewige Moralist, hatte Protest eingelegt gegen Hans Filbinger, den von der baden-württembergischen CDU für die Bundesversammlung nominierten Wahlmann; hatte den zukünftigen Präsidenten gewarnt vor der Beschädigung des Amtes, wenn er sich darin einführen lasse „von einem ruchlosen Soldatenmörder“. Dieser von der Öffentlichkeit schnell aufgenommene, aber ebenso schnell verpuffte Protest war wie der Abgesang auf eine alte, längst abgeschlossene Affäre: einen der großen Politikskandale in der Bundesrepublik, der seinen Ausgang nahm von einem Buch – Hochhuths Erzählung „Eine Liebe in Deutschland“ – und endete mit dem Rücktritt eines deutschen Ministerpräsidenten.
„Eine Liebe in Deutschland“ erzählt von der tödlich endenden Beziehung einer deutschen Frau zu einem polnischen Zwangsarbeiter. Erstmals wurde hier das Schicksal der Zwangsarbeiter in Nazideutschland exemplarisch aufgegriffen, eine bis heute noch nicht „erledigte“ Geschichte, wenngleich die Zeiten mancherorts schon als so weit normalisiert erscheinen, dass Hochhuths Buch auf kultusministeriellen Beschluss hin im vorigen Jahr von der Liste der Pflichtlektüre für baden-württembergische Abiturienten gestrichen und durch Patrick Süskinds „Das Parfüm“ ersetzt wurde.
1978 war „Eine Liebe in Deutschland“ erschienen und Filbinger – mehr in Folge seines verbohrten Leugnens und der Uneinsichtigkeit in begangenes Unrecht als wegen eines von ihm in letzter Kriegsminute gefällten Todesurteils – als Ministerpräsident Baden-Württembergs zum Rücktritt gezwungen. Ein seltener Fall unmittelbarer Wirkung von Literatur. Dass die Jury gerade dieses Buch des – nicht zuletzt als unnachsichtiger Frager nach der Mitschuld von Papst Pius an der Vernichtung der Juden – unbequemen, wenn nicht verhassten Autors 1980 für den ersten Geschwister-Scholl-Preis benannte, fand verständlicherweise nicht ungeteilte Zustimmung. Auch nicht bei den Stiftern, dem Verband
Bayerischer Verlage und Buchhandlungen und der Stadt München. Dennoch hatten beide, rühmte bei der Laudatio der Preisredner Armin Eichholz, Verleger und Stadtrat, „zum größten Teil entgegen ihrer abweichenden Meinung es ein paar unabhängigen Leuten überlassen“, den ersten Träger des großen Münchner Buchpreises zu bestimmen, nämlich einen Mann, von dem alle wissen: „Wo Sie hinschreiben, erwächst Skandal.“
Nun, der Skandal fand nicht statt. Und er würde auch in Zukunft nicht stattfinden, wenngleich die Juryentscheidungen nicht immer unumstritten waren. Ausnahme, aber nicht wirklich skandalös, eher eine Irritation: Die späte Forderung der Münchner CSU, Christa Wolf wegen ihrer Tätigkeit als IM der Stasi nachträglich den Preis für den 1987 ausgezeichneten „Störfall“, eine literarische Antwort nicht nur auf Tschernobyl, abzuerkennen. Und die Entscheidung 1994. Damals distanzierten sich die CSU-Mitglieder im Stadtrat ausdrücklich vom Vorschlag der Jury: von Heribert Prantl und seinen politischen Essays „Deutschland – leicht entflammbar“. Doch diese Verweigerung blieb einmalig, und was sich im dritten Jahr des Preises, als es um die autobiographische Poetik des Franz Fühmann „Der Sturz des Engels“ ging, als Eklat andeutete, wurde auch keiner. Es gab eben keine schrillen Pfiffe aus der rechten Ecke gegen eine „linksverdächtige Jury“, wie ein Kommentator mutmaßte: Um Verschiebung der Entscheidung über den – damals sagte man das noch so – „DDR-Autor“ Fühmann hatte ein Stadtrat deshalb gebeten, damit seine Fraktionskollegen Gelegenheit hätten, dieses „hervorragende und sehr eindrucksvolle Buch“, diesen verzweifelten Bildungsroman, auch zu lesen.
Im Jahr vor Fühmann hatte Reiner Kunze den Geschwister-Scholl-Preis erhalten: für seinen Gedichtband „Auf eigene Hoffnung“, angeblich, so war es im „Börsenblatt“ zu lesen, eine Kompensation, weil dem Stadtrat der in die Bundesrepublik emigrierte Dichter wegen seines Widerstands gegen die DDR nach Hochhuth eben zupass kam. Weil ein Dichter der Widerständler an sich sei, sagte Werner Ross in seiner Laudatio.
Der Geschwister-Scholl-Preis, so steht es in den Statuten, wird verliehen für ein Buch, das geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem verantwortungsvollen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben. Das sind vernünftige Kriterien, einhaltbar, weit genug gefasst, um so unterschiedliche Publikationen wie die republikanischen Texte von Walter Dirks (1983), Ernst Klees Forschungen über die NS-Medizin und ihre Opfer (1997), Hans Deichmanns Episoden privater deutscher Geschichte (1996), das Erinnerungsbuch „Meine deutsche Frage“ von Peter Gay (1999) oder die Briefe auszuzeichnen, die Helmuth Graf von Moltke an seine Frau Freya schrieb. Erst spät wurden sie veröffentlicht, erst spät, 1989, 44 Jahre nach der Hinrichtung Moltkes in Plötzensee, öffentlich gewürdigt, stellvertretend für alle Männer und Frauen, die dem Terror widerstanden, seine Opfer wurden.
Dieses große Dokument des Widerstands – eines wie im Fall der „Weißen Rose“ erfolglosen, dennoch notwendigen, auch wirksamen Widerstands – kommt dem hohen, nur annähernd einzuholenden Anspruch des Preises am nächsten. Einen „unmöglichen Preis“ nannte ihn Habermas. Denn da steht ja immer, als Maß der Dinge, dieser Name, steht das Beispiel von Hans und Sophie Scholl, dieses jeden, Juroren, Laudatoren, die Preisträger, entmutigende Beispiel von Mut. Singulär. „Atemberaubend“, wie es der frühere Innenminister Burkhard Hirsch in seiner Laudatio auf den Psychoanalytiker Arno Gruen formulierte, in dem „Gegensatz zwischen der klarsichtigen Beschreibung der herrschenden Verhältnisse einerseits, zwischen dem Mut, das Leben zu riskieren, um sechs Flugblätter zu verteilen, sie in Briefkästen und in den Lichthof der Universität zu werfen, und der völligen Aussichtslosigkeit des Unterfangens andrerseits, auf diese Weise eine Diktatur zu
stürzen“.
Jeden Preisträger packt der Skrupel des Selbstzweifels, stellt er sich diesem Vergleich. „Ich frage“, so Saul Friedländer, der als Kind in einem französischen Internat der Vernichtung entging, „ob ich den Mut gehabt hätte. Und ich antworte, ich hätte vielleicht dies oder das getan, aber einen solchen absoluten Mut traue ich mir nicht zu.“ Vielleicht nicht absoluter, so doch bemerkenswerter Mut und Menschlichkeit sind bezeugt in den Aufzeichnungen der Helene Holzman („Dies Kind soll leben“, 2000), die, selbst bedroht, im von den Deutschen besetzten Kaunas jüdische Menschen vor der Ermordung rettete. Oder in der Überlebensgeschichte von Marianne Strauß, die Mark Roseman aufgezeichnet hat („In einem unbewachten Augenblick“, 2003).
Man könne „nicht verlangen, dass jemand ein Held sei, aber dass er kein Schurke ist und kein Lügner“, sagte Jan Philipp Reemtsma bei seiner Laudatio für Friedländer, in einer Nebenbemerkung zu Martin Walser und dessen keineswegs missverständlichen Frankfurter Rede, in der er das böse Wort von der „Instrumentalisierung von Auschwitz“ in die Debatte einbrachte – ein Argument, wenn es das denn gebraucht hätte, für die über die ganzen 25 Jahre seines Bestehens andauernde Aktualität des Geschwister- Scholl-Preises. Die Notwendigkeit der Erinnerung – sie wurde immer neu begründet, ob durch Neonazis, die Hatz auf Ausländer machten, oder Bundestagsabgeordnete, die beifallheischend vom „Tätervolk“ der Juden raunten. So zeigt sich die Rückschau auf einen nicht politischen, sondern der Literatur gewidmeten Preis als eine Chronik auch der Zeit. Denn natürlich nahmen die Juroren Stellung zu den laufenden Ereignissen: zum Ost-West-Dialog, zu Tschernobyl, zum 11. September, zu dem unsäglichen Historikerstreit um die (geleugnete) Einzigartigkeit von Auschwitz, der merkwürdigen Auseinandersetzung über Gesinnungs- und Verantwortungsethik, zu den zahlreichen Versuchen der Geschichtsentsorgung. „Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen“ – dieses Zitat aus dem vierten Flugblatt der „Weißen Rose“ ist gültig bis in die Jetztzeit.
Die in den vergangenen Jahren von der Jury erwählten Erinnerungsbücher sind vermutlich die letzten, in denen direkte Zeugen, Opfer und Retter, deutscher Geschichte und des Umgangs mit ihr zu Wort kamen. „Bald wird es keine Zeugen der Vernichtung mehr geben“, schreibt Jorge Semprun in der Einführung zum Buch dieses Jahres, Soazig Aarons kühner Rekonstruktion von Erinnerung, „Klaras NEIN“. „Niemand wird mehr versuchen können, uns zu sagen, was der Rauch der Nazikrematorien über den Ebenen und Hügeln des alten Europas bedeutete.“ Gewiss, es werde gelehrte Arbeiten geben. Aber wenn die Zeugen verschwunden sind, werde die Vernichtung „nur noch eine historische Gegebenheit sein, faktisch erwiesen, aber entfremdet in der objektiven Kälte der Wissenschaft, außerhalb des Bewussten. Es sei denn, „dass die Romanschriftsteller, die Dichter der neuen Generation den Mut finden, die unerschöpfliche Wahrheit der Vernichtungserfahrung mit den Mitteln der Fiktion herauszuarbeiten.“
„Ästhetischen Mut“ auszuzeichnen – eines der Kriterien für die Vergabe – wie mit der Wahl der Tagebuch-Erzählung der französischen Autorin Aaron, des schmalen Lyrikbandes von Reiner Kunze, Cordelia Edvardsons Roman „Gebranntes Kind sucht das Feuer“ (1986), Grete Weils Roman „Der Brautpreis“ (1988) oder Georges-Arthur Goldschmidts Erzählung „Die Absonderung“ (1991), hatte die Jury des Geschwister-Scholl-Preises nicht immer Gelegenheit. Aber umgekehrt das Glück, dass wissenschaftliche Werke ausdrücklich auch ihrer literarischen Qualität wegen zu preisen waren: Saul Friedländers Opus magnum „Das Dritte Reich und die Juden“ über die Jahre der Verfolgung, 1998 ausgezeichnet, gehört zu diesen raren Beispielen, das Maßstäbe für die Geschichtsschreibung setzte, durch die Fülle der Information, die analytische Präzision, die Empathie, die außergewöhnliche sprachliche Qualität. Ein Buch, so Reemtsma, das Geschichte so beschreibt, „dass in ihr die Dimension der Freiheit, damit der Verantwortung und damit die der Moral nicht verschwindet“.
Wissenschaftliche Werke wurden erst spät in die Kandidatenliste für den Geschwister-Scholl-Preis aufgenommen. Jürgen Habermas’ Sammlung publizistischer Arbeiten mit dem längst Schlagwort gewordenen Titel „Die neue Unübersichtlichkeit“ (1985) gehört in diese Kategorie; die parallel zu der Fernsehreihe 1990 erschienene Dokumentation über die Vernichtung der europäischen Juden, für welche die Fernsehpublizistin Lea Rosh und der Historiker Eberhard Jäckel den Celan-Titel „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ wählten; Heft 7 der von Wolfgang Benz und Barbara Distel herausgegebenen „Dachauer Hefte“ zum Thema „Solidarität und Widerstand“ (1992); Wolfgang Sofskys „Die Ordnung des Terrors“ (1993), eine Strukturanalyse des Konzentrationslagers; Arno Gruens Arbeit über die Ursachen von Gewalt und Grausamkeit, „Der Fremde in uns“ (2001). Schließlich 2002 Raul Hilbergs „Die Quellen des Holocaust“.
Mit der Auszeichnung dieses im Schaffen des Historikers Hilberg eher peripheren Buchs würdigte die Jury, streng genommen entgegen der Satzung, das Lebenswerk dieses nie zu höheren akademischen Würden gekommenen „Nestors der Geschichtsschreibung des Holocaust“ (Mommsen): vor allem „Die Vernichtung der Juden“, ein Standardwerk mit äußerst mühseliger Publikationsgeschichte. Seine Laudatio auf den akademischen Außenseiter machte Hans Mommsen zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für die funktionalistische Theorie und für eine primär auf Akten, erst in zweiter Linie auf Zeugnisse von Überlebenden setzende Geschichtsschreibung.
Geschichtsschreibung, wie sie – auch, nicht ausschließlich – Anja Rosmus-Wenninger betrieb. Ihre Recherche über Widerstand und Verfolgung am Beispiel ihrer Heimatstadt Passau, hervorgegangen aus dem Schülerwettbewerb „Deutsche Geschichte“, machte Furore – und Ärger. Sie selbst machte Furore – und bekam Ärger, als sie, in Archiven suchend, Zeitzeugen befragend, einen Zipfel jener Schwarzweißdecke lüftete, die von Stadt und Kirche über die „braune Vergangenheit“ gebreitet worden war. Mit damals 24 Jahren ist sie die jüngste jemals mit dem Geschwister-Scholl-Preis geehrte Autorin; die erste Frau außerdem. Mit ihr geriet 1984 der in seinen Anfangsjahren von der Öffentlichkeit nicht eben mit brennendem Interesse bedachte Preis in die Schlagzeilen, „Zeit“ und „Spiegel“ und auch die Boulevardpresse brachten Artikel über die unbequeme Bürgerstochter Anja und den „Münchner Mutpreis“.
Eine ähnliche Wirkung in der öffentlichen Wahrnehmung hatte die Preisvergabe an Walter Nowojski und Hadwig Klemperer, die Herausgeber von Victor Klemperers Tagebüchern der Jahre 1933 bis 1945. Die zwei Bände von „Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten“ waren fesselnder Lesestoff, ein einmaliges historisches Dokument zudem, weil diese Chronik des alltäglichen Faschismus, die akribische Schilderung der Ereignisse, da Tag um Tag die Garotte von Erniedrigung und Verfolgung sich enger um die deutsche Juden legte, den Brückenschlag zwischen der bürokratischen Verfolgungsmaschinerie und dem fassungslosen Ausgeliefertsein der Opfer ermöglichte (Götz Aly). Die Sensation des Buchherbstes 1995 waren diese Tagebücher – und weit über den Tag hinaus, mit Auswirkung auch auf die anderen Werke Klemperers. Auf Grund des – auch in Verkaufszahlen zu messenden – Erfolges wurde das „Curriculum vitae“ neu aufgelegt, wurde die Herausgabe auch der Tagebücher der Jahre 1918 bis 1932 und die aus der Zeit in der DDR „Zwischen allen Stühlen“ realisierbar, wurde ein Preis für Toleranz mit Klemperers Namen gestiftet, ein Symposion zu Ehren des Romanisten Klemperer an der Humboldt-Universität veranstaltet, Gedenktafeln an Häusern angebracht. 300 000 mal wurde der Doppelband „Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten“ verkauft und er ist immer noch erhältlich. Wie übrigens die meisten der mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichneten Bücher noch erhältlich sind. Ein Beweis für die Hellsicht der Juroren? Oder Folge ihrer Auslese? Beides trifft zu. So ist der Geschwister-Scholl-Preis zu loben nicht nur als moralische Anstalt, als die Stimme der Erinnerung, als das böse Gewissen der Vergesslichen. Ist zu loben auch dafür, weil er Bücher heraushebt aus dem Elend der schnell vergänglichen Ware, zu der das Buch heute geworden ist.